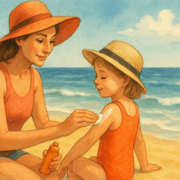Zwei Naturarzt-Autoren beschäftigen sich mit unterschiedlichen Facetten des Themas Sonnenstrahlung. Während HP Christian Zehenter Bedeutung und Möglichkeiten des Sonnenschutzes beschreibt, legt Dr. med. Konrad Taubert ein Plädoyer für die fast vergessenen heilsamen Wirkungen des Sonnenlichts vor. Einander ergänzende und gegeneinander abzuwägende Argumente sind bei diesen unterschiedlichen Standpunkten vorprogrammiert. Es lohnt sich, beide Positionen zu überdenken, und letztendlich entscheidet – wie so oft – auch das richtige Maß.
Sonnenlicht ist ein Lebenselixier für Haut, Immunsystem, Psyche und Stoffwechsel. Doch kann die natürliche UV-Strahlung zwischen April und August binnen 15 Minuten Haut-, Augen- und Gefäßschäden, langfristig sogar Hautkrebs verursachen. Bis zur Hälfte der UV-Strahlung durchdringt auch Wolken, Kleidung und Sonnenschirme. Stress pur für die Haut. Daher kommt es auf richtigen Sonnenschutz an.
Bis ins frühe 20. Jahrhundert galt eine helle Haut als schick, weshalb Hüte und Sonnenschirme überall Verwendung fanden. Einerseits traten hierdurch seltener Hautkrankheiten auf. Leicht stellte sich jedoch andererseits ein Vitamin-D- und damit ein Kalziummangel ein, denn Vitamin D entsteht vor allem in UV-bestrahlter Haut und stellt Kalzium für Muskeln, Nerven, Stoffwechsel, Knochen und Zähne bereit. Befindlichkeits-, Konzentrations-, Muskel- und Nervenstörungen sowie eine erhöhte Krankheitsanfälligkeit sind häufige Folgen, in ausgeprägten Fällen auch Knochen- und Gelenkdeformationen.
Sonnenlicht belebt den Menschen seelisch und körperlich. Es stimuliert den Stoffwechsel (auch der Haut), aktiviert unser Immunsystem und wirkt stimmungsaufhellend. Im Winter gehören daher 20 Minuten direkte Sonne zum gesunden Alltag. Neben einem steigenden Vitamin-D-Spiegel gehen damit auch Hautstörungen wie Neurodermitis und Schuppenflechte zurück. Doch im Sommer trifft gegenüber dem Winter pro Tag etwa die 50-fache Sonnenstrahlung auf die Erde! Alle Lebewesen verfügen dazu über einen natürlich Schutz, ob Fell, Gefieder, Schuppen, Panzer oder Wachsschicht – bis auf den Menschen. Denn mit der Verwendung von Kleidung verlor er in der Evolution sein Haarkleid bis auf „ästhetische Reste“ und konnte sich damit der meisten Parasiten entledigen, für den Preis langer, schützender Kleidung und einer angepassten Hautfarbe: Völker in Äquatornähe wehren mit einer dunklen Haut die energiereiche Strahlung ab, während sie in Richtung der Pole immer heller und durchscheinender wird, um ausreichend davon aufzunehmen.
Doch das Gleichgewicht hat sich verschoben: Denn aufgrund des Ozonabbaus in der oberen Atmosphäre infolge der früher als Treibgas und Kühlmittel verwendeten FCKW stieg die UV-Strahlung in den letzten Jahrzehnten um 15 Prozent an. Obwohl dies schon in den frühen 70er-Jahren bekannt war, wurde die FCKW-Verwendung erst 1987 (endgültig 1992) gestoppt.
Hautalterung, Netzhautschäden durch Sonnen-Überdosis
Gleichzeitig galt bis zu dieser Zeit eine markig gebräunte Haut als Sinnbild für Jugend und Gesundheit. Die Spätschäden wurden bald offensichtlich: vorzeitige Hautalterung, unzählige Leberflecken, Hautkrebs, grauer Star, Augen- und Bindehautentzündungen sowie Netzhautschäden wie die stetig zunehmende Makuladegeneration (Zerstörung der Netzhaut im Bereich der Blickfeldmitte) – rund 35 Prozent der über 75-Jährigen leiden darunter, mit Einschränkung der Sehfähigkeit bis hin zur Erblindung.
Auch das Immunsystem, das von maßvoller Sonnenbestrahlung durchaus profitiert , wird durch überdosierte UV-Strahlung (hierbei geht es jeweils vor allem um UVB-Strahlung) geschwächt, was Infekte, Allergien und wiederum die Krebsentstehung fördern kann.
Gegen maßvolle UV-Strahlung verfügt die Haut über bewährte Schutzmechanismen: Bei Sonnenbestrahlung bilden die Pigmentzellen (Melanozyten) mehr Farbstoff (Melanin) und wandern aus tiefen Hautschichten an die Oberfläche – die Haut bräunt. Zudem verdickt sich die Hornhaut. Man spricht von einer „Lichtschwiele“. Doch beide Schutzmechanismen benötigen zwei bis drei Wochen, um sich voll zu entfalten. Stimmen Sie Ihre Haut daher vor einem Urlaub schrittweise auf die Sonne ein, z. B. mit zunächst fünf Minuten direkter Sonne ab 15 Uhr und einer Steigerung von täglich zwei Minuten über drei Wochen.
Grundsätzlich sollten Sie Ihre Haut jedoch zwischen April und August von 10 bis 15 Uhr möglichst wenig der direkten Sonne aussetzen. Tun Sie es den Einwohnern südlicher Länder gleich und bleiben Sie in dieser Zeit im Haus, zumindest aber im totalen Schatten (z. B. Ziegel- oder Holzdach) Tragen Sie im Freien lange, undurchsichtige Kleidung und eine Kopfbedeckung, unabhängig vom Wetter. Achtung: Was wir wahrnehmen, ist allein die harmlose Infrarotstrahlung, nicht die aggressive UV-Strahlung. Daher verleitet der Fahrtwind auf einem Schiff oder Fahrzeug ebenso zur Sonnenüberdosis wie kühles Wetter. Im Gebirge kommen erhöhte UV-Strahlung mit niedrigen Temperaturen zusammen, am Meer spiegelnde Wasseroberflächen mit frischem Seewind. Bekamen Sie schon einmal einen Sonnenbrand bei geschlossener Wolkendecke, unter Ihrer Kleidung oder einem Sonnenschirm? Dies ist häufig der Fall, da nahezu überall UV-Strahlung vorhanden ist, wo Sonnenlicht hinfällt, ob unter Wolken, Markisen, Sonnenschirmen oder dünner Kleidung – jeweils etwa bis zu 50 Prozent.
Sonnenschutzmittel – Lizenz zum Sonnenbad?
Sonnencremes versprechen ungestraftes Sonnenbaden über Stunden: Ein Lichtschutzfaktor (LSF) von 30 verlängert die Zeit, die Sie unbeschadet in der prallen Mittagssonne verbringen können, angeblich um das 30-Fache, also z. B. 7,5 Stunden statt 15 Minuten. Hoffentlich haben Sie dies nie ausprobiert, denn das Ergebnis wäre wahrscheinlich eine großflächige Hautverbrennung mit gefährlicher Kreislaufbeeinträchtigung: Der Lichtschutzfaktor gilt nur für Laborbedingungen und sollte etwa bei einem Fünftel der angegebenen Werte angesetzt werden. Cremes – auch „wasserfeste“ Produkte – werden außerdem durch Schweiß und Wasser größtenteils abgewaschen oder mit dem Abtrocknen entfernt und zersetzen sich ohnedies innerhalb einer Stunde. Erneutes Eincremen ist erforderlich, entfaltet seine volle Wirkung allerdings erst nach 30 Minuten.
Zum anderen verursachen die Zusätze von Sonnencremes unter anderem Allergien und „Mallorca-Akne“: Die akneartigen Knötchen werden vor allem durch Emulgatoren, Duft- und Konservierungsstoffe ausgelöst. Zudem enthalten Sonnencremes normalerweise chemische Filter – Substanzen mit Namen wie Benzophenon, Trisiloxan oder Drometrizol, die in die Haut eindringen und UV-Licht in harmloses Infrarotlicht umwandeln. Ihre hormonartige Wirkung steht allerdings im Verdacht, das System der Schilddrüsen- und Sexualhormone zu beeinträchtigen und hormonsensible Krebsarten (z.B. viele Brustkrebsformen) zu begünstigen.
Dennoch sind Sonnenschutzmittel gesünder als Sonnenbrand: Wenn Sie also Ihre Haut länger als zehn Minuten direkter Sonne aussetzen, sollten Sie mindestens 30 Minuten zuvor eine Sonnenschutzcreme mit hohem Lichtschutzfaktor (20 oder höher) auftragen. Diese sollte licht-, wasser-, schweiß- und hitzebeständig sein und sowohl vor UV-B-Strahlung, die Sonnenbrand verursacht, als auch vor UV-A-Strahlung schützen, die z. B. Hautalterung und „Sonnenallergie“ (20 Prozent, meist Frauen zwischen 20 und 40 Jahren) zur Folge hat. Aufgrund der Zersetzung oder dem Abtragen der Filtersubstanzen sollte stündlich nachgecremt werden.
Mineralische Filter, die häufig in Naturkosmetika Verwendung finden, schützen die Haut mit feinstem Zink-, Magnesium- oder Titanoxidpuder und können deshalb ab LSF 20 weißlich schimmern. Sie sind nach bisherigem Wissensstand deutlich verträglicher als die chemischen Varianten. Doch muss hier besonders auf Zuverlässigkeit, Wasserbeständigkeit und gründliches Auftragen geachtet werden. Tipp: Setzen Sie Sonnenschutzmittel zunächst versuchsweise auf kleinen Flächen ein, ohne einen ausgeprägten Sonnenbrand oder eine Hautreaktion zu riskieren.
Sonnenschutzmittel sind für verschiedene Hauttypen (mehr fettend oder feuchtend) und Zielgruppen (Sportler, Urlauber, Bergsteiger) erhältlich. Normalerweise reicht LSF 20 aus, bei sonnenempfindlicher Haut oder hoher Bestrahlung (z. B. Gebirge) bietet sich ein Sunblocker (ab LSF 40) an. Achten Sie beim Eincremen darauf, auch schwer erreichbare Hautpartien wie Ohren, Lippen (hier evtl. Sonnenschutz-Lippenstift) sowie lichtdurchlässig behaarte Bereiche zu erfassen. Die Mittel eignen sich nicht für den täglichen Dauergebrauch oder gar als Freibrief, die Haut gezielt der Sonne auszusetzen. Bräunungscremes schützen übrigens ebenso wenig vor der Sonne wie Solarienbesuche.
Auch bestimmte Nahrungsmittel bieten einen gewissen Sonnenschutz, etwa im Bereich von Lichtschutzfaktor 1. Zwar können sie es damit nicht mit Sonnenschutzmitteln aufnehmen, sie verdoppeln aber immerhin die Widerstandsfähigkeit der Haut. Wer z. B. reichlich Tomaten (besonders Tomatenmark) isst, schützt seine Haut durch die enthaltenen Lykopine. Auch Sanddornfrüchte (z. B. als Fruchtfleischöl, täglich 3-mal 10 Tropfen zwei Wochen vor dem Urlaub), Karotten, Paprika und Heidelbeeren (Betakarotin) besitzen Sonnenschutzeigenschaften, während Sellerie und Pastinaken die Sonnenempfindlichkeit leicht erhöhen.
Verschiedene weitere Mittel machen ebenfalls vorübergehend sonnenempfindlicher, darunter Antibiotika, Schmerz-, Akne- und Entwässerungsmedikamente, viele Psychopharmaka, Entzündungshemmer, Johanniskraut, Duftstoffe in Kosmetika (Parfüm, Waschlotion etc.) sowie Insektenspray. Letzteres führt bei gleichzeitiger Verwendung von Sonnenschutzmitteln häufig zu Unverträglichkeitsreaktionen.
Sonnenbrand: lebenslang im „Hauptgedächtnis“
Ein Sonnenbrand ist medizinisch eine Verbrennung ersten (Rötung, Brennen) oder zweiten (außerdem Blasenbildung) Grades. Die Haut ist zu Teilen zerstört und benötigt etwa zwei Wochen, um sich zu regenerieren. Zellen werden repariert oder abgestoßen, eine Entzündung signalisiert die hohe Immunaktivität. Der Sonnenbrand ist dabei bereits als Heilreaktion entstandener UV-Schäden zu verstehen. Doch diese hinterlassen Spuren und bleiben der Haut ein Leben lang im „Gedächtnis“. So besteht im Bereich häufig oder intensiv besonnter Hautpartien auch noch nach Jahrzehnten ein deutlich erhöhtes Krebsrisiko.
Wenn es zum Sonnenbrand kommt, kühlen Sie die Haut, z. B. mit Quarkumschlägen (kühlen Quark dick auf ein Tuch streichen und Stoffseite ca. 30 Minuten auf die Haut legen), trinken Sie reichlich und verzichten Sie ein bis zwei Wochen auf direkte Sonne. Auch kühle Auflagen mit Ringelblumen- oder Kamillentee, Johanniskraut- und Lavendelöl oder entzündungshemmende Kühlgele beschleunigen die Heilung. Bei Babys und Kleinkindern oder ausgeprägter Blasenbildung, starken Schmerzen, Nackensteifigkeit oder Übelkeit sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Autor:
Christian Zehenter, Jahrgang 1972, Diplom-Sozialpädagoge, Heilpraktiker und Baubiologe, war Redakteur beim Naturarzt und der Deutschen Heilpraktiker Zeitschrift. Er arbeitet als Autor und Medizinjournalist. Für den Naturarzt verfasst er Gesundheits-Checks und Artikel. Zuletzt schrieb er u. a. über Medizinische Bäder (1/2012), Medizinische Leitlinien (8/2011) und „Krank durch Medikamente“ (5/2011).
Entnommen aus dem „Naturarzt“ Juni 2012
Welche Art von Sonnenschutz nötig ist und wie lange man sich in der Sonne aufhalten kann, hängt auch vom Hauttyp ab.
Tipps zum Sonnenschutz
Die wichtigsten Sonnenschutzmaßnahmen auf einen Blick:
► Schatten, undurchsichtige Kleidung, breitkrempiger Hut
► die Haut über einige Wochen an die Sonne gewöhnen
► von April bis August zwischen 10 und 15 Uhr direkte Sonne vermeiden, auch ansonsten in diesen Monaten vor direkter Besonnung der Haut immer eine Sonnenschutzcreme verwenden
► Solarium meiden
► besondere Vorsicht unter Wolken oder Beschattung, bei kühlem Wetter oder Fahrtwind (z. B. Gebirge oder Schiff), Schnee, großen Höhen und Wasseroberflächen
► Sonnenbrille mit UV-Schutz (CE- oder UV-400-Zeichen am Bügel), besonders bei sonnigem Wetter, Auto- oder Fahrradfahren
► T-Shirt und Hut/Kappe beim Baden
► Haut nicht zu stark bräunen
► Pkw-Seitenscheiben mit UV-Schutz (häufig ist nur die Frontscheibe damit ausgestattet)
► im Winter täglich mindestens 20 Minuten Tageslicht im Freien (Fensterscheiben filtern größtenteils das UV-Licht)
► Alle Schutzmaßnahmen gelten besonders für Kinder und nochmals verschärft für Säuglinge und Kleinkinder.
Das Eincremen mit konventionellem Sonnenschutz entfaltet erst nach 30 Minuten seine volle Wirkung.
Sonnenschutz nach Hauttyp
Merkmale: Rötliche Haare, grüne bis blaue Augen, helle, empfindliche Haut, häufig Sommersprossen, immer Sonnenbrand bei direkter Sonne, keine Bräunung
Empfohlener Sonnenschutz: Keine direkte Sonne von April bis August, schützende Kleidung (Kopfbedeckung, lange Hosen, langärmeliges Oberteil)
Typ: 1
Merkmale: Blonde Haare, blaue bis graue Augen, helle Haut, Sonnenbrand nach einer Stunde, leichte Bräunung nach einer Woche
Empfohlener Sonnenschutz: Max. 30 Minuten direkte Sonne (zu Beginn 10 Minuten). Lichtschutzfaktor 20
Typ: 2
Merkmale: Braunhaarig, graue bis braune Augen, selten Sonnenbrand, deutliche Bräunung nach einer Woche
Empfohlener Sonnenschutz: Max. 60 Minuten direkte Sonne (zu Beginn 15 Minuten). Lichtschutzfaktor 20, nach der Bräunung Faktor 8
Typ: 3
Merkmale: Schwarze Haare, braune Augen, nie Sonnenbrand, rasche starke Bräunung
Empfohlener Sonnenschutz: Max. 60 Minuten direkte Sonne, Lichtschutzfaktor 8 Typ
Typ: 4